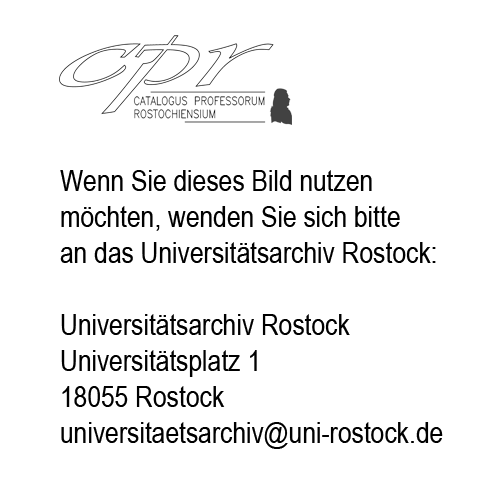

| Vater: | Konrad Pegel, Professor der Pädagogik, Rhetorik, Mathematik an der Univ. Rostock
 ) ) |
| Mutter: | Anna Pegel, geb. Bolte (1513-1585) |
| Ehefrau: | Anna Pegel, geb. Stüwe (?-1605) |
| Tochter: | Anna Pegel (1595-1641) |
| andere: | Schwager, David Chytraeus, Professor für christliche Katechese, später der Theologie an der Univ. Rostock
 ) ) |
| andere: | Schwager, Levin Battus, Professor der Niederen Mathematik, später Medizin und Höheren Mathematik, Univ Rostock
 ) ) |
| Schulbesuch in Rostock (?) | |
| 1556-1569 | Studium (?), Univ. Rostock |
| 1569-1572 | Rektor der Regentie "Rubri Leonis", Rostock |
| 1572-1575 | Dozent an der philosophischen Fakultät, Univ. Rostock |
| 1575-1581 | Professor der Mathematik, Univ. Helmstedt |
| 1581-1590 | Bildungsreisen nach Italien und Forschungstätigkeit in Rostock |
| 1591-1604 | Professor der Mathematik und Astronomie (rätlich), Univ. Rostock |
| 1605-1612 | Hofmathematiker bei Kaiser Rudolf II., Prag |
| 1612-1619 (?) | Aufenthalt bei Philipp von Pommern, Stettin |
| 1619 | In Stettin verstorben (?) |
| Promotion | 1569 | Mag. art., Univ. Rostock |
| Promotion | 1581 | Dr. med., Univ. Rostock |
| Gilt als Erfinder der Bluttransfusion. |
| Machte sich in seinem Thesaurus theoretische Gedanken zu Luftschiffen, Unterseebooten, Maschinengewehren und weiteren Erfindungen. |
| Universi Seu Mundi Diatyposis. Rostock 1586. |
| Thesaurus Rerum, Selectarum, Magnarum, Dignarum, Utilium, Suavium, Pro generis humani salute oblatus. Rostock 1604. |
| Aphorismi Thesium Selectarum De Corporibus Mundi Totius Primariis, Universalibus, Maximis, Pulcherrimis. Rostock 1605. |
| Jügelt, Karl-Heinz: Magnus Pegel (1547-1616/18). Versuch der Rekonstruktion einer Biografie. In: Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock 32 (2012), S. 33-103. |
| Fleischhauer, Elisabeth: Magnus Pegel - bedeutender Gelehrter an der Universität Rostock um 1600. In: BGUR 14 (1990), S. 11-23. |
Omodeo, Pietro Daniel: Sixteenth Century Professors of Mathematics at the German University of Helmstedt. A Case Study on Renaissance Scholarly Work and Networks. (Hier S. 7-9) [Preprint auf den Seiten des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte Berlin]
 ) ) |
Hofmeister, Adolf: Conrad und Magnus Pegel. In: Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock 4 (1907) 4, S. 55-62.
 ) ) |
| Etwas von gelehrten Rostockschen Sachen 1737: S. 373, S. 465, S. 469 ; 1738: S. 174, S. 217, S. 460 ; 1739: S. 151, S. 419, S. 728, S. 779, S. 794, S. 799, S. 830 ; 1740: S. 115, S. 201, S. 391 ; 1741: S. 432 ; 1742: S. 322, S. 615, S. 618 ; 1743: S. 16, S. 53, S. 250 |
| Krey, Joh. Bernh.: Andenken an hiesige Gelehrte 4. Stück (1814): S. 45-48 ; Anhang (1816): S. 54 |
| Krey, Joh. Bernh.: Beiträge zur mecklenburgischen Kirchen- und Gelehrtengeschichte Zweiter Band (1821): S. 56 |
|
GND: 124820468
[GND-Link auf diese Seite: https://cpr.uni-rostock.de/resolve/gnd/124820468] |
|
Pietro Daniel Omodeo: Magnus Pegel (Rostock 1547-Stettin (?) 1618(?)): Kurzbiographie: Als Sohn des Mathematikers Konrad Pegel (1487-1567) in Rostock geboren. Er studierte in seiner Heimatstadt, wo er 1569 sein Studium abschloss. Mit Hilfe seines Schwiegervaters, David Chyträus, und vielleicht durch Brucaeus, wurde er bereits 1575 in Helmstedt zum Professor für Mathematik ernannt, ein Jahr vor der Eröffnung der Universität. Er lehrte Geometrie nach Euklids Elementen und Grundlagen der Astronomie nach Sacroboscos De Sphaera, oder nach den Lehrbüchern des flämischen Gelehrten Cornelius Valerius.[1] 1581 wurde er aus seinem Amt entlassen, was an seinem ausschweifenden Verhalten lag, welches wiederum seinem Alkoholmissbrauch geschuldet war. Herzog Julius wollte ihn zwar in Wolfenbüttel als Hofmathematiker halten, möglicherweise um seine technischen Fähigkeiten nutzen zu können, jedoch entschied sich Pegel zur Rückkehr in seine Heimatstadt. Zurück in Rostock erreichte Pegel einen medizinischen Abschluss und arbeitete wahrscheinlich für eine Weile als Arzt. 1591 wurde er Professor für Mathematik an der Universität Rostock und lehrte hier bis zu seiner Abberufung 1605, welche möglicherweise auch aufgrund seiner kosmologischen und Weltansichten erfolgte. Daraufhin floh er nach Prag an den Hof Rudolf II, wo er bis zu dessen Tod im Jahr 1612 lebte. Wahrscheinlich verzog er danach nach Stettin, wo Herzog Philip von Pommern herrschte. Hier verstarb er vermutlich um 1618.[2] Aus seinen Briefen wissen wir, dass er mit den Landgrafen Wilhelm IV und Moritz von Hessen-Kassel vertraut war. Beide waren großzügige Förderer der Astronomie und ihres Instrumentenbauers Jost Bürgi, der wegen seiner Geschicklichkeit international bekannt war.[3] Pegel berichtet ebenfalls davon, dass er Tycho Brahe in Dänemark besuchte, welchen er für seine astronomischen Instrumente und Datenaufzeichnungen bewunderte, nicht jedoch für dessen geo-heliozentrische Kosmologie, welche er ablehnte.[4] Er hielt sich ebenfalls für einige Zeit in Florenz auf, wo er Sternenbeobachtungen durchführte und diese mit denen in Rostock verglich, um den Erdradius zu vermessen.[5] Arbeiten und Ansichten: Vier Veröffentlichungen Pegels sind erhalten geblieben: Universi seu mundi diatyposis (Rostock, 1586) und Aphorismi thesium selectarum de corporibus mundi totius primariis (Rostock, 1605), welche sich beide mit Astronomie und Naturphilosophie beschäftigen. Eine dritte Veröffentlichung, Thesaurus rerum selectarum (Rostock, 1604), befasst sich mit medizinischen und technischen Erfindungen, zugleich aber auch mit Gedanken zur Rechtswissenschaft. Die vierte Schrift ist eine Lobrede der Typographie, eine Oratio von 1594, die sprachphilosophische Bemerkungen einschließt.[6] Diese Publikationen lassen eine ausgeprägte technische und philosophische Fantasie und einen außergewöhnlichen Blick auf naturwissenschaftliche Vorgänge erkennen. Unter den Erfindungen, die im Thesaurus vorgestellt werden, ist eine Rudolf II gewidmet. Andere sind ehrgeizig und überraschend, so zum Beispiel das Projekt eines U-Bootes (navigium submarinum sive subaquaeum singulare), dessen Durchführbarkeit allerdings schwer zu glauben ist. Seine bemerkenswertesten philosophischen und kosmologischen Thesen waren: der Kosmos ist eine endliche Sphäre, eingeschlossen in ein unendliches Weltall; die materielle Himmelsphären, die nach dem traditionellen Weltbild die Gestirne transportieren, sind reine Fiktionen, die keiner physikalischen Realität entsprechen; der Himmel ist homogen und besteht aus aer (eine Art von Luft); alle Himmelskörper (Sterne, Planeten und Kometen) sind aus den selben Elementen geschaffen; Sterne und Planeten sind mit Leben erfüllt; die Astronomie wäre besser bedient ohne mathematische Hypothesen, weil physikalische Erklärungen den mathematischen Darstellungen vorzuziehen sind. Außerdem war Pegel ein Anhänger des Planetensystems von Martianus Capella, dem entsprechend Merkur und Venus die Sonne anstatt der Erde umkreisen. Er wertete ebenfalls die Möglichkeit eines physikalischen Vakuums um, das er überraschenderweise gleich mit einem absoluten leeren Ort (locus sine corpore) und einem vitalistischen Fundament der Natur setzte.[7] Alle diese Thesen weisen auf eine radikale, gegen Aristoteles gerichtete Weltsicht hin, die Gemeinsamkeiten mit Giordano Brunos Spekulationen hatte (Anti-Aristotelismus, Vitalismus, Annahme des physikalischen Vakuums und des Grundsatzes der kosmologischen Homogenität, Unendlichkeit des Weltraums) und mit Tycho Brahe (die Fluidität des Himmels und ansatzweise der Geo-Heliozentrismus). Darüber hinaus können die Ansprüche an eine Astronomie sine hypothesibus auf den französischen Philosophen Pierre de la Ramée zurückverfolgt werden, der traditionelle mathematische Denkansätze in der Astronomie zurückwies. [8] Die Veröffentlichung von Universi seu mundi diatyposis entfachte schnell ablehnende Reaktionen bei einigen Gelehrten in Helmstedt. Dort verfasste der schottische Magister John Johnston nämlich zwei Disputationen zu Gunsten der Kosmologie Aristoteles’ und zur Verteidigung der fundamentalen Konzepten der scholastischen Physik (Raum, Zeit und der Unhaltbarkeit der physikalischen Leere). Diese waren offensichtlich gegen Pegels Thesen von räumlicher Homogenität, Vakuum und partiellem Geo-Heliozentrismus gerichtet.[9] Verbindungen: Rostock (Ausbildung durch Konrad Pegel, David Chyträus und Brucaeus); Hven (Brahe); Kassel (Wilhelm IV und Moritz von Hessen-Kassel und Bürgi); Florenz; Prag; Stettin. Pietro Daniel Omodeo (2011). Übersetzung aus dem Englischen: Matthias Glasow [1] Ordo Lectionum 1581: "M. Magnus Pegelius geometrica ex Euclide, Astronomica vero ex Cornelio Valerio hora octava proponit." [2]Vgl. dazu Hofmeister, "Conrad und Magnus Pegel", Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock 4/4 (1907): 55-62; Biegel, Gerd: "Pegel Magnus", Eintrag in Horst-Rüdiger Jarck, Braunschweigisches Biographisches Lexikon, (Braunschweig 2006), 553-554. [3]Pegel, Thesaurus rerum selectarum (Rostock 1604), 73-4. [4]Ebenda, 75-6. [5]Pegel, Aphorismi thesium selectarum (Rostock 1605), ff. B1r-v: "Globi terreni circuitus integer seu circumferentia maxima 5400 miliaria germanica circiter complectitur […]. [tesi 45] Quod sic satis verum esse […] ego quoque Florentiis in Italia, utcumque quantum occasio tulit observatione deprehendi, latitudiem illius cum Rostochiana ex locorum inprimis hinc inde collata et in directum conformata intercapedine conferens. Intervalla enim locorum duorum remotiorum, et non multum ab eodem meridiano dissitorum convenienter assumuntur". [6]Pegels Oratio befindet sich in Augustus Iunior Brunsvicensium et Lunaeburgensium Dux et Rostochiensis Aca-demiae Rector, Orationes et edicta publice proposita (Rostock 1594), Bl. A3v sqs. [7]Für eine detaillierte Analyse der naturwissenschaftlichen Ansichten Pegels vgl. Omodeo, Pietro Daniel: "Disputazioni cosmologiche a Helmstedt, Magnus Pegel e la cultura astronomica tedesca tra il 1586 ed il 1588", Galilaeana 8 (2011). [8]Vgl. Jardine, Nicholas and Segonds, Alain: "A Challenge to the Reader: Ramus on 'Astrologia' without Hypotheses", in Mordechai Feingold, Joseph S. Freedman and Wolfgang Rother, The Influence of Petrus Ramus (Basel 2001), 248-66. [9]Omodeo, "Disputazioni". |
| Magnus Pegel (Kupferstich, Porträtsammlung, UAR) | |
|---|---|
| pegel_magnus_pic.jpg (90.7 KB) MD5 (als Portrait anzeigen) |
|
| Falkenberg, Paul: Die Professoren der Universität Rostock von 1600 bis 1900. Manuskript um 1900, S. 32 (UAR). | |
| falkenberg_albumprof__p0032.jpg (554 KB) MD5 (keine Anzeige) |
|
| Dokument (Pietro Daniel Omodeo: Magnus Pegel) | |
| pegel_magnus_bio.html (9.57 KB) MD5 (als Biogr. Artikel anzeigen) |
|
| pegel_magnus_sig | |
| pegel_magnus_sig.jpg (32.7 KB) MD5 (als Unterschrift anzeigen) |
|