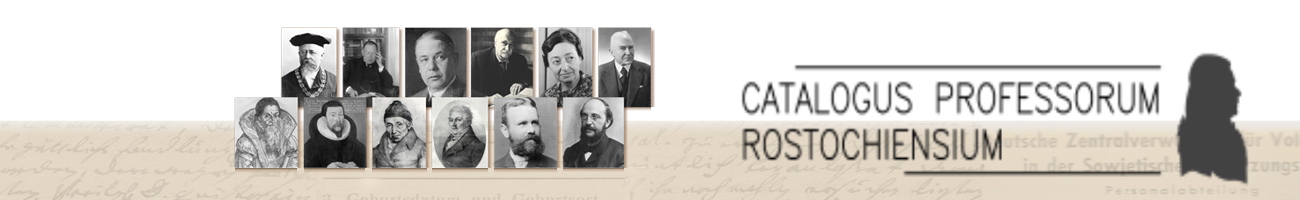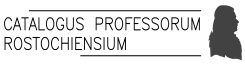| 1925 | Abitur, Ballenstedt (Harz) |
| 1925-1928 | Lehrling, später Verwalter bei der Zuckerfabrik Hoym in Hoym (Anhalt) |
| 1928-1931 | Studium der Landwirtschaftswissenschaften an den Univ. Jena und Halle |
| 1932-1933 | wiss. Assistent in der Versuchswirtschaft für Schweinehaltung Ruhlsdorf |
| 1934-1937 | wiss. Assistent am Tierzuchtinstitut, Univ. Halle |
| 1937-1945 | Hauptgeschäftsführer des Reichsverbandes deutscher Schweinezüchter in Berlin |
| 1945-1949 | Tierzuchtwart und Dozent für Tierzucht, Univ. Halle |
| 1949-1952 | Professor für Tierzucht an der Univ. Rostock, Leiter des Zentrums für Tierzucht in Dummerstorf bei Rostock |
| Übersiedlung in die BRD | |
| 1952-1972 | Professor für Tierzucht und Haustiergenetik, Univ. Göttingen |
| Studium | 1931 | Dipl.-Landwirt, Univ. Halle |
| Promotion | 1932 | Dr. rer. nat., Univ. Halle Titel der Arbeit: Fruchtbarkeit und Fruchtbarkeitsvererbung in der Edelschweinzucht der Provinz Sachsen. |
| Habilitation | 1949 | (Tierzucht), Univ. Halle Titel der Arbeit: Mast- und Schlachteigenschaften und ihre Beziehungen zum Typ verschiedener Schweinerassen und deren Kreuzungen. |
| 1968 | Uovo d'Oro („Goldenes Ei“), Award der Univ. Mailand für herausragende wiss. Beiträge |
| 1976 | Richard-Götze-Medaille der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter |
| 1977 | Ehrenmitglied der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter |
| 1982 | Thaer-Thünen-Medaille in Silber der Albrecht-Thaer-Gesellschaft in Celle, Niedersachsen (zugleich im Namen der Landwirtschaftskammern von Weser-Ems und Hannover) |
| 1984 | Hermann-von-Nathusius-Medaille |
| 1987 | Verdienstkreuz I. Klasse des Verdienstordens der BRD |
| Zusammen mit Hammond, John; Johansson, Ivar (Hg.): Handbuch der Tierzüchtung, 3 Bände, Hamburg 1958 bis 1961. |
| Rassenkunde, Hamburg 1961. |
| Schafzucht, 4. Aufl, Stuttgart 1975 bis 7. Auflage 1984. |
| Personalakte Fritz Haring, UAR; zusammengestellt von Marlon Gollnisch, Rostock |
| Angaben durch Hartmut Boettcher |
| Gerber, Theophil: Persönlichkeiten aus Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau und Veterinärmedizin. Bd. 1, 2. Aufl., Berlin 2004, S. 267. |
| Comberg, Gustav: Haring, Fritz (1907). In: Die deutsche Tierzucht im 19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart 1984, S.692. |
| Aktuelle Probleme, Schwerpunkte und Entwicklungen der Tierproduktion in Wissenschaft und Praxis. Tierzüchterisches Kolloquium zum 75. Geburtstag von Fritz Haring. Göttingen 1982. |
Deutsches Biographisches Archiv II 524, 46. (WBIS)
 ) ) |
|
GND: 142394114 [GND-Link auf diese Seite: https://cpr.uni-rostock.de/resolve/gnd/142394114] |
| Fritz Haring (Foto, ohne Jahr, UAR) | |
|---|---|
| haring_fritz_pic.jpg (52.8 KB) MD5 (als Portrait anzeigen) |
|
| Dokument (Biographischer Artikel von Marlon Gollnisch, 2009) | |
| haring_fritz_biog.html (7.7 KB) MD5 (als Biogr. Artikel anzeigen) |
|
|
Fritz Haring wurde am 11. Januar 1907 in Dessau geboren. Sei Vater war im Ersten Weltkrieg an der Westfront gefallen. Seine Mutter verstarb kurz nach seiner Geburt. Aufgrund des frühen Verlustes beider Elternteile wuchs Haring bei seinem Großvater im Harz auf. Dort besuchte er auch das Woltersdorf-Gymnasium in Ballenstedt ab 1914. Nach elf Jahren Schulausbildung in jenem Gymnasium erhielt er sein Abitur. Haring stammte aus einer alten provinzial-sächsischen Schäfermeisterfamilie, wodurch er ein hohes Interesse an Tierzucht und Landwirtschaft entwickelte. In den folgenden drei Jahren verdiente Haring seinen Unterhalt bei der Zuckerfabrik Hoym. Er begann seine Tätigkeit für dieses Unternehmen in Neustadt/Harz als Lehrling und nach mit „gut“ bis „sehr gut“ abgeschlossener Prüfung bei der Landwirtschaftskammer Anhalt arbeitete er direkt in Hoym als Verwalter in der genannten Zuckerfabrik. Ab 1928 studierte er in Jena und Halle an der Saale Landwirtschaft. Nach sechs Semestern erhielt er sein Diplom als Landwirt mit der Note „sehr gut“. An das Studium schloss sich eine Sonderausbildung in Spezialzweigen der Tierzucht an. Im Jahr 1932 nahm Haring sodann eine Stelle als wissenschaftlicher Assistent bei der Versuchswirtschaft für Schweinehaltung in Ruhlsdorf an. Im folgenden Jahr wurde er Mitglied der SA. Nach drei Jahren verließ er diese paramilitärische Abteilung und wurde Mitglied in der NSDAP. In der Zwischenzeit, 1934 bis 1937, war er als wissenschaftlicher Assistent am Tierzuchtinstitut der Universität Halle tätig. Haring hatte bereits 1934 das erste Mal geheiratet. Aus dieser Verbindung ging sein Sohn, Friedrich-Karl, hervor. 1940 heiratete er seine zweite Frau Margarete, mit der er einen zweiten Sohn, Hans Joachim Friedrich, zeugte. Nicht zuletzt durch seine Mitgliedschaft in den genannten NS-Organisationen konnte Haring zwischen 1937 und 1945 den Posten des Hauptgeschäftsführers des Reichsverbandes Deutscher Schweinezüchter bekleiden. Im August 1944 begann sein Militärdienst bei der Volks-Grenadier-Division 549. Ende November 1944 wurde er in Ostpreußen so schwer verletzt, dass ein Oberschenkel amputiert werden musste und seine rechte Hand verkrüppelte. Nach dem Krieg trat Haring der SPD bei. Da er sich in der SBZ aufhielt, war er ab 1946 SED-Mitglied. Ebenfalls 1945 wurde er Mitglied der Gewerkschaft IG-Land und des FDGB. Zwischen 1945 und 1949 arbeitete er als Tierzuchtwart und -berater sowie als Dozent an der Universität Halle. 1949 habilitierte Haring in Halle an der Saale.[1] Am 23. April 1949 berief ihn die Universität Rostock zum außerordentlichen Professor für Tierzucht. Kurz darauf, am 1. Mai, wurde ihm die Leitung des Zentrums für Tierzucht in Dummerstorf bei Rostock übertragen. Im August 1952 erhielt er ebenfalls den Posten des Direktors des Institutes für Tierzucht, welches er jedoch nicht mehr ausübte, da er im selben Monat das Staatsgebiet der DDR verließ und eine Professur in Göttingen annahm. Von der Georg-August-Universität in Göttingen hatte er bereits in der Mitte des Jahres einen Ruf bekommen. In einem Schreiben vom 10. Juni 1952 vom Dekan der Landwirtschaftlichen Fakultät an das Ministerium für Volksbildung des Landes Mecklenburg heißt es: „Dem Ministerium ist ferner ebenfalls bekannt, daß Prof. Haring gleichzeitig einen sehr ehrenvollen Ruf nach einer Fakultät in Westdeutschland erhalten hatte, diesen aber aufgrund seiner politischen Überzeugung ablehnte, um seine Kraft dem Wiederaufbau der DDR zur Verfügung zu stellen.“ Aus dem Schreiben geht weiter hervor, dass sich sowohl das Ministerium in Mecklenburg als auch das übergeordnete in Berlin gegenseitig die Schuld zuwiesen, dass Haring nach drei Semestern noch immer keine formelle Bestätigung der Professur erhalten hatte. Der Dekan drängte an dieser Stelle, dass das Ministerium Mecklenburgs endlich handeln möge, da man Haring sonst verlieren würde, was man natürlich nicht wollte, da es sich in dieser „Angelegenheit [um] eine Prestigefrage“ handelte. Dazu kam es jedoch nicht mehr. Im August schrieb Haring an den Rektor der Universität Rostock, Professor Dr. Schlesinger: „Hochverehrte Magnifizenz! Ich erlaube mir, meine Tätigkeit als Inhaber des Lehrstuhls für Tierzucht und Direktor des Instituts für Tierzucht der Universität Rostock hierdurch nach der gesetzlichen Kündigungsfrist von 14 Tagen zu kündigen. Ich habe mich entschlossen, die am 31. Juli ausgesprochene Berufung auf den Lehrstuhl für Tierzucht der Georg-August-Universität Göttingen anzunehmen.“ Nach seinem Umzug war Haring 1958 Mitherausgeber des Grundlagenbuches für Tierzüchter Handbuch der Tierzucht, welches „für alle wiss. arbeitenden Tierzüchter ein unentbehrliches Informationsmittel geworden ist."[2] Sein wohl wichtigstes Werk entstand ebenfalls in Göttingen: Schafzucht erschien bis 1984 in der siebten Auflage. Im selben Jahr erhielt Haring die Hermann-von-Nathusius-Medaille. Seit 1928 wird von der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde e.V. im Gedenken an Hermann Engelhard von Nathusius, einem bedeutenden deutschen Tierzüchter, diese Medaille gestiftet. Mit der im Regelfall jährlichen Verleihung werden Persönlichkeiten geehrt, welche sich in der Tierzucht und Produktkunde ausgezeichnet haben.[3] 1972 wurde Haring altersbedingt emeritiert, stand der Georg-August-Universität jedoch auch im Ruhestand weiterhin zur Verfügung.[4] Am 24.9.1990 verstarb Fritz Haring in Göttingen.[5] Marlon Gollnisch, Studentenbeitrag aus dem Jahr 2009.
|
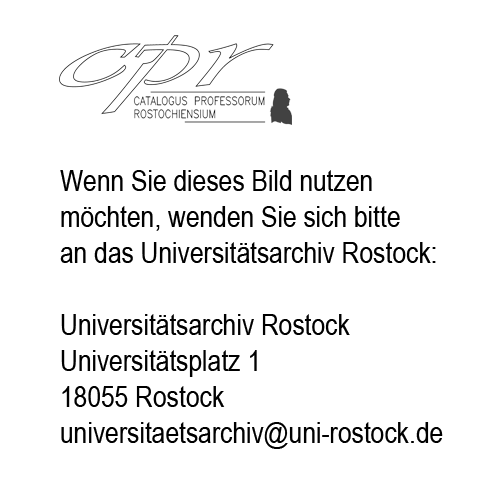

Universitätsplatz 1
18055 Rostock